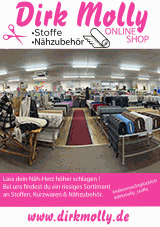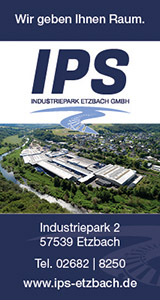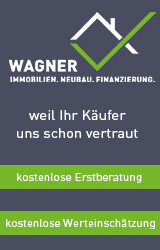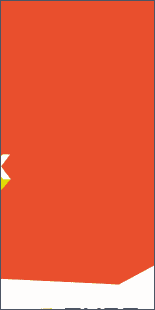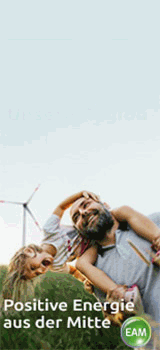Unser Klima: Zu kompliziert, um es zu planen
Das System Erde und die Klimadebatte müssen ganzheitlicher, komplexer verstanden werden. Diese Ansicht vertritt der Geowissenschaftler Reinhard Hüttl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ in Potsdam, der auf Einladung der Westerwald Bank in Ransbach-Baumbach sprach.
Ransbach-Baumbach. Was wissen wir eigentlich wirklich über das Klima? Keine Frage, das 21. Jahrhundert ist Zeitzeuge einer vergleichsweise starken globalen und schnell ablaufenden Klimaänderung. Seit dem Einsetzen der Industrialisierung vor etwa 140 Jahren stieg die globale Mitteltemperatur um etwa 0,8 Grad Celsius an. Und außer Zweifel steht auch, dass neben natürlichen Ursachen der Mensch mit seinem Handeln, in erster Linie durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und der damit verbundenen Freisetzung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid in die Atmosphäre, beteiligt ist. Allerdings: Das Klima unterliegt nicht nur menschlichen Einflüssen. „Das System Erde und die Klimadebatte“ müssen ganzheitlicher, komplexer verstanden werden, wie der renommierte Geowissenschaftler Reinhard Hüttl bei der Vortragsveranstaltung mit gleichem Titel in Ransbach-Baumbach erläuterte. Hüttl ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ in Potsdam und seit 2011 Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Seit 2008 steht er der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) als Präsident vor. Seine Botschaft ist klar, aber für manchen, der sich in der Weltsicht einer menschengemachten Klimaveränderung eingerichtet hat, auch unbequem: „Das System Erde braucht nicht nur eine Klimadebatte.“
Wilhem Höser, Vorstandssprecher der Westerwald Bank, hatte eingangs auf die verbreitete Annahme hingewiesen, dass die derzeit erkennbaren Klimaveränderungen durchweg von Menschen gemacht seien. „Das Klimasystem ist aber so komplex, dass auch die weit gediehene Forschung noch Lücken aufweist und manche Detailfrage kaum beantwortet werden kann.“ Reinhard Hüttl machte die Komplexität dann erkennbar und pochte in seinen Ausführungen auf eine gesamtheitliche Betrachtung der Wechselwirkungen von fester Erde (Geosphäre), Wasser (Hydrosphäre), Eis (Kryosphäre), Luft (Atmosphäre) und des Lebens (Biosphäre).
Die Pole wandern
„Das Erdmagnetfeld schützt uns vor kosmischer Strahlung, wobei es in der Erdgeschichte immer wieder Umpolungen des Feldes gab“, erläuterte der Wissenschaftler zum Beispiel mit Blick auf Nord- und Südpol. Was sich dahinter verbirgt, sorgte für Erstaunen: Denn die magnetischen Pole seien nicht örtlich fixiert, sie wandern im Verlauf von zehn Jahren um rund 16 Kilometer. „Die letzte dieser geomagnetischen Exkursionen, die wir feststellen konnten, war vor etwas 40.000 Jahren und hat rund 2.500 Jahre angedauert.“ Hüttl skizzierte die Bewegung des Nordpols bis hin auf die Südhalbkugel und zurück. „Wir vermuten, dass es in dieser Zeit zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzfunktion des Magnetfeldes kommt.“
Damit nicht genug beim Blick auf das System Erde: Eiszeitliche Überlagerungen, so Hüttl, bewirken beispielsweise bis heute noch Hebungen der Landmassen, etwa in Skandinavien. Schwerefeldanomalien, dargestellt im Modell der so genannten Potsdamer Schwerekartoffel, führen zu globalen Meeresspiegeländerungen. Bei der Schwerekartoffel handelt es sich um eine Darstellung der irdischen Anziehungskraft in Gestalt einer deformierten Erdkugel, bestimmt aus der präzisen Vermessung der Flugbahn von Geoforschungssatelliten. Das Auseinanderbrechen des Urkontinents Pangäa vor rund. 250 Mio. Jahren halte heute noch an und sei als Kontinentaldrift bekannt. Sie ist Auslöser für Gebirgsbildungen, Vulkanismus und Erdbeben. Die Biosphäre sei nicht nur an der Erdoberfläche sichtbar, sondern reiche bis in Tiefen von mehreren Kilometern. Wichtig für die Energieversorgung: Dies ist auch ein Grund dafür, dass Erdöllagerstätten auf natürliche Weise durch anaerobe Bakterien abgebaut werden. Die Reichweite der Kohlenwasserstofflagerstätten schließlich reiche bei heutigem Verbrauch länger als 100 Jahre. Kohlenlagerstätten seien weitaus größer, völlig ungenutzt seien die Gashydratlagerstätten in den Meeren.
Erderwärmung half Hannibal über die Alpen
Reinhard Hüttl, der die Bundesregierung in Fragen der Energiewende berät, machte deutlich, dass „das Klima mit so vielen Komponenten des Systems Erde eng verknüpft ist, dass bei Änderungen die klimatischen Folgen praktisch gar nicht exakt vorhergesagt werden können. Das Klima ist viel zu kompliziert, um es zu planen. Und es unterliegt einem steten Wandel. Stabilität gibt es in der Natur nur über bestimmte, eher kurze Zeiträume, nie aber auf Dauer.“
Der Blick auf die jüngere Erdgeschichte machte deutlich, wie vergleichsweise kurzfristig kleinere Veränderungen stattfinden, die im Vergleich zur restlichen Erdgeschichte jedoch sehr stabil erscheinen: Vor 8.200 Jahren zum Beispiel sackten die Temperaturen in Mitteleuropa innerhalb weniger Jahrzehnte um durchschnittlich ein bis zwei Grad ab. Der nächste Klimaschock ereignete sich vor rund 5.300 Jahren: Damals sank im Pirotal im Schweizer Kanton Tessin die Baumgrenze abrupt um 100 Meter nach unten. Pollenanalysen deuten auf eine rasche Abkühlung um gut zwei Grad hin. In dieser Zeit begannen die Gletscher der Alpen rasch zu wachsen. Als die Römer vor 2.100 bis vor 1.600 Jahren ihr Weltreich entfalteten, half ihnen dabei - wie auch wahrscheinlich der Alpen-Überquerung Hannibals mit seinen Elefanten - ein Ausschlag des Klimapendels in die andere Richtung. Vor rund 1600 Jahren begannen die Gletscher dann erneut zu wachsen, in weiten Teilen Europas fielen die Temperaturen, Niederschläge nahmen zu. Bis vor rund 1300 Jahren lagen die Temperaturen ein bis eineinhalb Grad niedriger als heute. Danach wurde es wieder wärmer. Im mittelalterlichen Klimaoptimum war es in der Zeit zwischen 800 und 1300 rund ein bis zwei Grad wärmer als vorher. Die Temperaturen erreichten so ein ähnliches Niveau wie zum Ende des 20. Jahrhunderts - damals ganz ohne menschengemachte Ozonkiller. (Andreas Schultheis)
Lokales: Ransbach-Baumbach & Umgebung
Feedback: Hinweise an die Redaktion