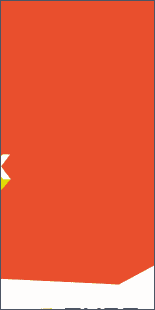Arzthaftung – Der schmerzhafte Wiedereingliederungsplan
Haftet ein Arzt für die Erstellung eines Wiedereingliederungsplans, der bei einem als Lagerist tätigen Patienten das Heben von Lasten bis zu 40 Kilogramm erlaubt, wenn sich dadurch die Schmerzen nach einer Oberschenkelhalsbruch-OP verschlimmern und sogar die Implantierung einer Hüftprothese erforderlich wird? Mit dieser Frage hatte sich die erste Zivilkammer des Landgerichts Koblenz zu befassen.

Region. Der Kläger ist von Beruf Lagerist. Er zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu, der operativ durch Einbringen von Schrauben im Krankenhaus versorgt werden musste. Nach circa 3 ½ Monaten wurden die eingebrachten Schrauben wieder entfernt. Der beklagte Arzt erstellte weitere 1 ½ Monate später – nach durchgeführter Röntgenuntersuchung – einen
Wiedereingliederungsplan für den Kläger, der auf der ersten Stufe eine Arbeitszeit von vier Stunden täglich bei einer Maximalbelastung von 40 Kilogramm vorsah. Die
Wiedereingliederungsmaßnahme brach der Kläger nach kurzer Zeit aufgrund von
Schmerzen im Frakturbereich ab. Eine Untersuchung ergab, dass sich der Bruch verschoben
hatte und der Hüftkopf geschädigt worden war. Dem Kläger musste ein künstliches
Hüftgelenk eingesetzt werden.
Der Kläger machte vor dem Landgericht Koblenz geltend, die Schädigung der Hüfte sei auf
den fehlerhaften Wiedereingliederungsplan zurückzuführen, der zu früh eine zu hohe
Belastung vorgesehen habe, weshalb ihm im Ergebnis das künstliche Hüftgelenk habe
implantiert werden müssen. Er verlangte vom behandelnden Arzt daher unter anderem Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes in Höhe von mindestens 16.000 Euro. Der Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, auf Basis der durchgeführten Röntgendiagnostik sei die stärkere Belastung erlaubt gewesen, binnen circa fünf Monaten sei eine Oberschenkelhalsfraktur in der Regel verheilt. Nicht der Wiedereingliederungsplan, sondern die zu frühe Entfernung der Schrauben durch das Krankenhaus hätte zu den Schädigungen geführt.
Die 1. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz verurteilte den behandelnden Arzt nach
Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens zur Zahlung eines
Schmerzensgeldes. Die Kammer war der Auffassung, dem Beklagten sei nach den
überzeugenden Ausführungen des gerichtlich bestellten Sachverständigen ein vermeidbarer
Diagnoseirrtum vorzuwerfen. Der Sachverständige habe dargelegt, auf Basis der gefertigten
Röntgenbilder sei die Erstellung des Wiedereingliederungsplanes nicht angezeigt, die
Empfehlung, Lasten bis zu 40 Kilogramm zu heben, behandlungsfehlerhaft gewesen. Die fehlende Knochenbruchheilung sei nämlich auf dem gefertigten Röntgenbild zu erkennen gewesen. Der Bruch beim Kläger sei noch nicht durchbaut – also hinreichend fest – gewesen. Der Diagnosefehler habe, so die Kammer weiter, auch zu einem Schaden beim Kläger geführt.
Dieser habe zwar nicht darin gelegen, dass dem Kläger ein künstliches Hüftgelenk habe
eingesetzt werden müssen, die Implantation sei nämlich auch bei richtiger Diagnose nicht zu verhindern gewesen. Der Beklagte habe den Kläger aber nicht sofort, wie es erforderlich
gewesen wäre, in das Krankenhaus zurückverwiesen, so dass der Kläger in einem Zeitraum
von etwas mehr als zwei Monaten – vom Beginn der Behandlung durch den Beklagten bis
zur Implantierung der künstlichen Hüfte – unter zunehmenden Schmerzen gelitten habe.
Diese erheblichen Schmerzen rechtfertigten, so die Kammer, im konkreten Einzelfall ein
Schmerzensgeldanspruch des Klägers in Höhe von 5.000 Euro.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. (PM Justizmedienstelle Landgericht Koblenz)
Feedback: Hinweise an die Redaktion